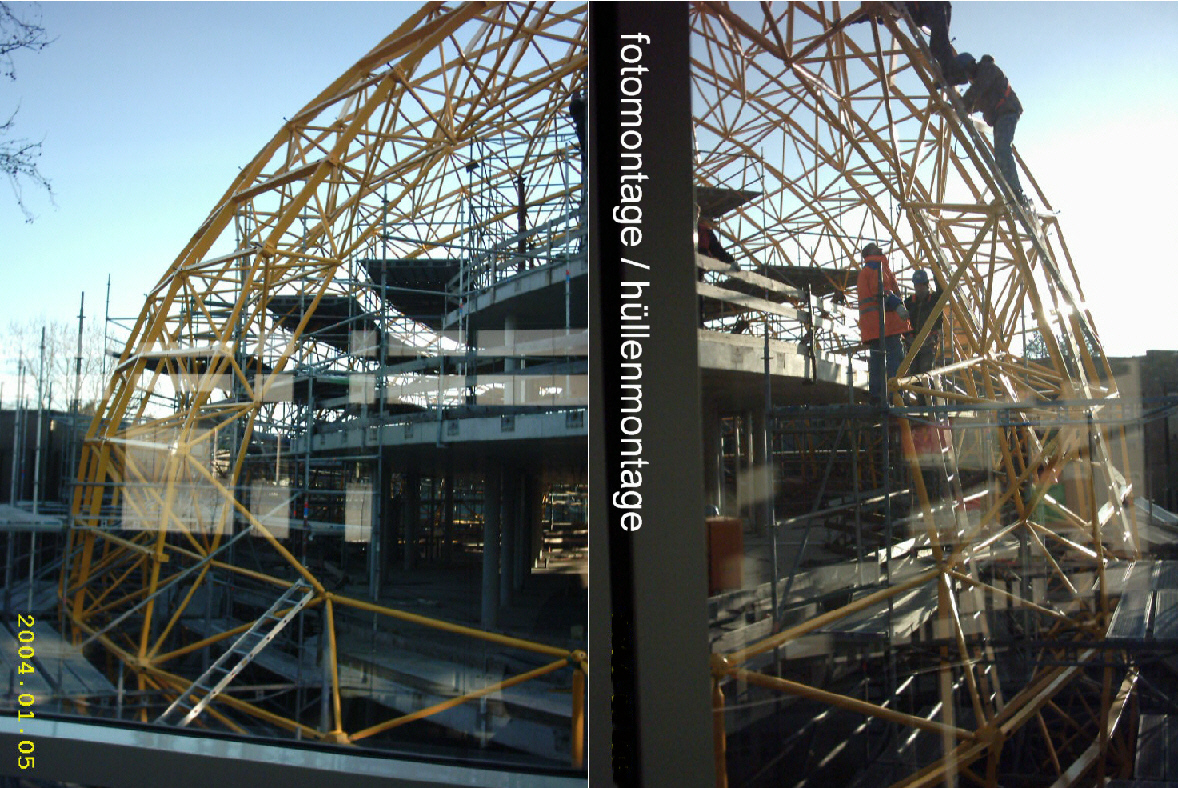The Brain
Die neue Philologische Bibliothek an der FU Berlin von Norman Foster
Ein Bericht zur Planungsgeschichte von Michael Krauss
Berlin: Das alte Zentrum und die Universität / Hochschul- und Wissenschaftslandschaft Berlin / Ausbau des alten Zentrums nach der Wende / Kein Spielraum für die Humboldt-Universität in der City / Adlershof: „déja-vue-Modell“?
Dahlem: Deutsches Oxford 1900 / Von der Domäne Dahlem zur Wissenschaftsstadt / 500 ha zu verteilen: Jansen-Plan (1910), Aufteilungsplan Domäne (1912) / Unvollendete Planung der Wissenschaftsstadt bis 1914-18 / FU-Gründung in der geteilten Stadt 1948 / Aktivierung der Reserveflächen / Rascher Ausbau der neuen Universität
FU -”Rostlaube” - Mythos oder Monstrum / Bebauung des ehem. Obstbaugeländes in Dahlem; Wettbewerb 1963 / Gesamtplanung der 60er Jahre: Entwurf von C-J-W / Exkurs: Team Ten (auch Team X) / Konzept eines flexiblen, langfristig gedachten Entwicklungsrahmens / Internationales Echo in Fachkreisen / fragwürdiger Nutzwert nach 30jähriger Nutzung / Architektur und Ideologie – Flexibilität, Variabilität, Demontabilität – offene Form
„Sonderfall“ FU-Bibliotheken: Von der Fach- (Instituts-) über die Bereichs- zur Universitätsbibliothek / Literaturversorgung und räumlich-bauliche Auswirkungen / Kapazitätsgrenzen / Integration der Philologischen Fächer auf dem Obstbaugelände
Die neue Philologische Bibliothek der FU
Organisatorisches und räumliches Modell / Neue Gemeinsame Bibliothek:
Planungsalternativen und Entscheidungsprozess /
Der Entwurf von Lord Norman Foster / Architektur und Funktionalität
Aktueller Zielkonflikt
Einerseits will der Berliner Senat den Ausbau, zumindest den Erhalt des
Sektors Hochschule und Forschung in Berlin. Industrie und Dienstleistung
sind ja seit langem rückläufig bzw. als Wirtschaftsfaktor gar nicht
mehr vorhanden. Andererseits ist die Stadt bekanntlich pleite. Der Senat
reduziert seit Jahren die finanzielle Ausstattung der Hochschulen (Bsp.:
Halbierung des FU-Personals seit 1992). Aktuell geht es immer noch (oder
wieder) um weitere Einsparungen im Hochschulbereich - trotz der Beteuerung
über den hohen Stellenwert der Wissenschaft für die Stadt. Argumente
für den Ausbau sind vor allem qualitativer Art („Investition in die
Zukunft“). Es gibt aber auch finanzielle Gründe: Jeder für den
Hochschulbereich ausgegebene Euro schafft eine dreimal so hohe gesamtwirtschaftliche
Nachfrage in der Stadt.
Standorte:
Berlin ist heute Standort von 4 Universitäten (HU,FU,TU,UdK) mit
(noch) 2 Klinika, außerdem mehrere Fachhochschulen; 130.000 Studierende auf 85.000 Studienplätzen;
hoher Anteil an Nicht-Berlinern. Kosten des gesamten Hochschulbereichs (einschl. Medizin): 1,2 Mrd. Euro pro Jahr.
Dazu kommen weitere Wissenschafts-Institutionen wie Max-Planck-Ges., Akademien u.a.m.
Neuordnung des Berliner Hochschulbereichs seit der Wende 1989:
Die Neuordnung des Hochschulbereichs in der wiedervereinigten Stadt nach
1990 konzentrierte sich zunächst auf die HU, die erst „abgewickelt“ und
dann neu aufgebaut wurde. Stadträumlich zeigt sich bald das Problem der
konkurrierenden Flächenansprüche. Hochschulstandorte werden aus
der City verdrängt, da diese vorrangig die Hauptstadtfunktionen aufnehmen
soll. Lösung: Auslagerungsstandort für die gesamten Naturwissenschaften
der HU in Berlin-Adlershof, quasi eine Neuauflage eines 100 Jahre zurückliegenden
Vorgangs: Die politisch gewollte Auslagerung großer Teile der Universität
an den Stadtrand und räumliche Vereinigung mit nichtuniversitären
Forschungseinrichtungen: Was heute bei der HU in östlicher Richtung realisiert wird, geschah zum
ersten Mal um 1900 als Ausgründung von Teilen der alten Berliner Universität
nach Südwesten Berlins auf landwirtschaftliche Flächen in Dahlem
Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Plan, große Teile der Berliner Universität
nach Dahlem zu verlegen: Dort sollen 500 ha Gutsfläche der Königlichen
Domäne einer neuen Nutzung zugeführt werden: Das preußische Finanzministerium
will die Flächen zunächst ausschließlich als teures Wohnbauland
verwerten. Der Wissenschaftslobby, insbesondere Althoff aus dem preußischen Kultusministerium
gelingt es, große Flächenteile für eine Wissenschaftsstadt,
ein „Deutsches Oxford“, zu reservieren. Der Druck auf die Grundstücke
in der City hatte seit der Reichsgründung ständig zugenommen. Universität
und Kultusadministration sahen dort keine Perspektive mehr für einen
Ausbau der wachsenden Universität. In dieser Wissenschaftsstadt in Dahlem
sollen zum einen Universitätsinstitute, vor allem botanische, pharmazeutische
und zoologische Fächer, Platz finden. Damit knüpfte man an die bereits
erfolgte Verlagerung des alten Botanischen Gartens aus Schöneberg nach
Dahlem an. Es wurde auch überlegt, die für Universitätskliniken
benötigten Flächen bereitzustellen, die in der Innenstadt nicht
mehr zu erhalten waren. Außerdem werden mehrere neu geschaffene wiss.
Institutionen (Reichsgesundheitsamt, Reichsamt für Materialprüfung,
Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft u. a.) noch vor
dem ersten Weltkrieg dorthin verlegt. Vor allem errichtet die Kaiser-Wilhelm-
(heute: Max-Planck-) Gesellschaft in rascher Folge eine Reihe von Instituten,
an denen in der Folge bedeutende Forschungen durchgeführt werden (Bsp.
Kernspaltung Otto Hahn und Lise Meitner).
Dahlempläne
Für Dahlem wurden verschiedene Bebauungsplanvorschläge entworfen.
Entscheidend ist der Plan von Hermann Jansen aus dem Jahr 1910, der eine typische Mischung
von Wohn- und Wissenschaftsflächen vorsieht; beiden Ansprüchen
– dem Wohnen wie der Wissenschaft – wird ausreichend Genüge getan. Der
Plan berücksichtigt auch die topografischen Verhältnisse und lehnt
sich landschaftsgestalterisch an angelsächsische Vorbilder an. Dieser
Plan stellt die Grundlage für den amtlichen Aufteilungsplan von 1912
dar: Die freien Flächen, auf denen die Einrichtungen der Wissenschaftsstadt
errichtet werden sollen, stehen unter dem Vorbehalt: „für Staatsbauten
reserviert“. Sie bleiben bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg im wesentlichen
unbebaut. In den Jahren bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs ist nur wenig
aus dem Verlagerungsprogramm realisiert worden. Auch in der Weimarer Zeit
tat sich wenig – die Lindenuniversität blieb in ihrem alten Rahmen.
Gründung der Freien Universität 1948
Aufgrund der zunehmenden Intoleranz der Leitung der Humboldtuniversität
kommt es 1948 zur Relegation und zum Auszug von zahlreichen Studenten, die
auf eine Gründung einer freien Universität im Westen Berlins drängen.
Dezember 1948 wird die FU gegründet. Die Anfänge sind zunächst
bescheiden; die neue Hochschule muß mit Provisorien leben. Bald schon
entstehen aber Pläne für eigene Neubauten; 1952 wird der Henry-Ford-Bau
eröffnet. Ende der 50er Jahre wird erkennbar, dass aufgrund der steigenden
Nachfrage nach Studienplätzen die FU ausgebaut werden muß; doch
der Flächenvorrat des alten Campus an der Garystraße ist erschöpft.
1960 wird ein 10-Jahresplan für den Gesamtausbau der FU beschlossen.
Mit dem Bau der Mauer 1961 wird die Notwendigkeit des Konzepts bekräftigt
– die wirtschaftliche Situation hat sich aber erst einmal wieder sehr verschlechtert.
Der Senat von Berlin sieht jedoch Priorität in der Entwicklung des Hochschulbereichs
und beschließt definitiv den Ausbau der FU in Dahlem. Dafür werden
die Flächen reaktiviert, die um 1900 für Wissenschaftsstandorte
in Dahlem vorgesehen worden waren.
(Am Rande ist zu bemerken, dass damit auch ein Konflikt im Stadtteil angelegt
wurde: Der erwachende Widerstand der Dahlemer Villenbewohner gegen die Bebauung
der freien Flächen für die FU sollte im Lauf der Jahre zunehmen.
Offensichtlich war das Konzept einer Stadt der Wissenschaft im Bewusstsein
nicht mehr präsent und die von Anfang an geplante Doppelnutzung des Stadtteils
inzwischen vergessen. Dahlem galt jetzt nur noch als privilegierter Wohnstandort,
an dem Studenten nichts zu suchen hatten – jedenfalls nicht, wenn sie sich
politisch artikulierten, wie das ab Mitte der 60er Jahre bekanntlich der
Fall war.Die in den 70er Jahren entstehende Massenuniversität ließ die
Grenzen der Belastbarkeit des Stadtteils Dahlem durch die FU deutlich werden.
Der Höhepunkt und zugleich Scheitelpunkt der quantitativen Entwicklung
war das Jahr 1992, als die FU mit 62.000 eingeschriebenen Studierenden die
größte deutsche Hochschule war. Inzwischen wurde die Studentenzahl
der FU auf 40.000 zurückgefahren (bei 24.500 finanzierten Studienplätzen)
und die Anzahl der Professuren seit 1962 halbiert.)
Der Senat von Berlin legte 1962 eine Standortplanung für Dahlem fest:
Diese ist Gerüst der künftigen räumlichen Verteilung aller
Fächer der FU (mit Ausnahme des Klinikums und der Veterinärmedizin).
Dafür sollten im Wesentlichen die unbebauten Flächen herangezogen
werden, die im Aufteilungsplan von 1912 „für Staatsbauten reserviert“
worden waren.
Wettbewerb „Obstbaugelände“ 1962/63
Das Kernstück des Flächenvorrats war das so genannte Obstbaugelände,
das sich zwischen der Thielallee im Westen und der Königin-Luise-Straße
im Osten erstreckte. Es war bis dahin interimistisch als Obstbauversuchsgelände
genutzt worden. 1962/63 wurde ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben.
Als Preisträger ging daraus das französische Team Candilis, Josic, Woods
hervor, das eine flache Bebauung vorschlug. Der Entwurf zeigte einen
im Wesentlichen zweigeschossigen
cluster, der von Fußgängerstraßen
durchzogen wurde, zwischen denen sich die Räume der Institute frei nach
den jeweiligen Bedürfnissen der Fächer anlagern sollten.
Der Entwurf für das Obstbaugelände wurde vor allem aus zwei Gründen
ausgezeichnet: Zum einen wurde die flache, so genannte Teppichbebauung als
adäquate städtebauliche Antwort auf die Dahlemer Villenlandschaft
angesehen, in die sich die neuen Baumassen rücksichtsvoll einfügen
sollten. Zum anderen war man von dem cluster aber auch deshalb angetan, da
diese Struktur besonders den damals hoch gehaltenen Kriterien der Flexibilität
und Variabilität zu entsprechen schien: Das Entwurfskonzept der Architekten
sah vor, das Wachsen und Schrumpfen der Institute, d.h. den ständigen
Wandel von Institutsnutzung und Institutszuschnitt durch ein Bausystem aufzufangen,
das keine den einzelnen Instituten zugeordneten fixen Raumquanten festlegen
sollte, sondern durchgehend frei unterteilbar war. Es sollte nur eine Struktur
vorgegeben werden ("Strukturalismus"). Deshalb sollte auch der gesamte Bau
keinen Anfang und kein Ende haben; man würde mit einem zufälligen
Ausschnitt aus dem System beginnen, z.B. mit den Strassen J, K, L und den
Quergassen 28 bis 33. (Auf diese Prämissen des Entwurfs und die Erfahrungen
mit der flexiblen Struktur soll später noch eingegangen werden.) Das
Bausystem sollte sich mit der Zeit in alle vier Richtungen erweitern – wodurch
aber die Grenzen der freigehaltenen Flächen auch überschritten würden
und mindestens die Villen in den Randbereichen entfernt werden müssten.
Exkurs: Team Ten (auch Team X)
Die Architekten Georges Candilis und Shadrach Woods und der am FU-Projekt beteiligte Partner Manfred Schiedhelm gehörten zur Gruppe des „Team Ten“. Sie sollten zunächst den zehnten CIAM-Kongreß im Jahre 1956 in Dubrovnik vorbereiten. Bereits bei der CIAM IX in Aix-en-Provence 1953 war es zum Bruch mit dieser Gruppe von jüngeren Architekten gekommen - Sprecher waren vor allem Alison und Peter Smithson sowie Aldo van Eyck . Die Auseinandersetzung betraf die Glaubenssätze der Charta von Athen, insbesondere die strikte Funktionstrennung (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr) und die Dominanz des Verkehrs. Diese Dogmen zu überwinden war Gegenstand der Arbeitstagungen des Team Ten, dem auch Jacob Bakema, Ralph Erskine und John Voelcker angehörten. (vgl. Kenneth Frampton, Die Architektur der Moderne,1983) Geforscht wurde nach den Bewegungskräften und Prinzipien städtischen Wachstums. Die nächstwichtige Einheit oberhalb der Zelle der Familie wurde gesucht. Propagiert wurde die Stadt auf mehreren Ebenen. Deutlich wird der Pluralismus an den in der Gruppe differierenden Einstellungen. Etwa bei Aldo van Eyck, der in seinen Arbeiten zurückgeht auf Formen primitiver Kulturen (vgl. Waisenhaus in Amsterdam) und das "labyrinthische" Prinzip vertritt. Candilis und Woods hatten in den frühen 50er Jahren eine Zeitlang bei Le Corbusier gearbeitet, so u.a. bei dem Projekt der Unité in Marseille. Eine Schlüsselrolle in der Arbeit von Woods spielt sein Wettbewerbsbeitrag für den Frankfurter Römerberg, den er 1963 mit Schiedhelm entwirft. Vorgeschlagen wurde eine „Miniaturstadt“, eine „labyrinthische“ Ansammlung von Läden, öffentlichen Bereichen, Büros und Wohnungen. Die orthogonale Form des Ensembles steht im Kontrast zur mittelalterlichen Form der Stadt. Diese Form der „Miniaturstadt“ finden wir dann wieder in dem Entwurf für das Obstbaugelände. Aber anders als in Frankfurt kann dieser Plan für Dahlem sich nicht in eine städtische Kultur im Umfeld einklinken. Interessant ist übrigens auch das letzte Projekt Le Corbusiers, nämlich der Entwurf eines Krankenhauses für Venedig, dessen Plan an die strukturalistischen Modelle von Candilis & Woods erinnert, wie sie auch im Wettbewerbsbeitrag für die Uni Bochum und dem realisierten Projekt für Toulouse-LeMirail zu erkennen sind.
Die Planung für die Bebauung des Obstbaugeländes beginnt Mitte
der 60er Jahre konkret zu werden. Sie wird aber, wie sich in der Folgezeit
zeigte, überfrachtet mit einem Übermaß von Zielen und Erwartungen:
Es sollten ja nicht nur die von der FU benötigten Erweiterungsbauten
errichtet werden – immerhin schon ein anspruchsvolles Programm – sondern man
dachte auch daran, ein universelles Bausystem für alle anstehenden Hochschulbauten
in Berlin aufzulegen. Derlei hatten andere, reichere Bundesländer wie
Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg schon erreicht; das gehörte nach damaligem Verständnis
zum Standard für den Hochschulausbau in der Bundesrepublik der 60er Jahre.
Eine Baufirma aus dem Hause Krupp wurde vom Berliner Senat mit der Entwicklung
beauftragt: Dies kostete viel Zeit und Geld – und es blieb dann letztlich
doch nur ein System für das FU-Obstbaugelände. Man experimentierte
auch mit neuen Baustoffen: Der Einbau der Rostfassade des ersten Abschnitts
wurde ohne ausreichende Erfahrungen mit der neuen Stahllegierung „Corten“
entschieden – die Schäden setzten früher ein als von Pessimisten
befürchtet.
1990 brachten Asbestfunde den Lehrbetrieb fast völlig zum Erliegen
und wurden Anlaß für eine Planung zur Generalsanierung der beiden
Abschnitte Rost- und Silberlaube. Sie ist bis heute noch längst nicht
abgeschlossen. Ein weiteres Problem: Das Gebäude nahm unter der enormen
Belastung durch Ströme von Nutzern und Besuchern, die sich in dem Labyrinth
nur schwer zurechtfanden, mit der Zeit auch Züge der Verwahrlosung an.
Aber trotz großer technischer Schäden und starker Abnutzung blieb
bis heute ein fester Kernbestand an architektonischer und räumlicher
Qualität des Bauwerks erhalten, so z.B. die reizvollen inselartigen Innenhöfe,
wo sich die Bewohner auch eigene Bereiche geschaffen haben.
Notwendige Neuordnung der Nutzungsstruktur
Zu Beginn der Planung wurde die These vertreten, eine flexible Nutzungsstruktur sei erstens in technischer Hinsicht besonders wirtschaftlich. Zweitens stelle diese auch die für die Institute und Wissenschaftler optimalen Bedingungen für Kommunikation und Kooperation her. Eine offene Raumstruktur erleichtere wesentlich das Herstellen von Kontakten. Aufgrund der nunmehr in 30 Jahren gewonnenen Erfahrungen kann man wohl feststellen, dass diese Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Die Frage ist nur, warum nicht! Lag es daran, dass die Größe der Universität sich gegenüber der ursprünglichen Planungsgrundlage so dramatisch verändert hat? Hat die Belastung durch den Betrieb der Massenuniversität den, wie manche sagen, an sich richtigen Ansatz der offenen Struktur konterkariert? Oder war die großflächige „labyrinthische“ Bauanlage (der Abstand zwischen den beiden begrenzenden Straßen beträgt rund 400 Meter!) eben doch das verkehrte Modell für einen Uni-Camps im Vorort Dahlem? (vgl. Frampton) Waren die Nutzer der Institute und die Uni-Verwaltung vielleicht nicht flexibel genug, die möglichen Chancen der flexiblen Struktur konkret wahrzunehmen? Oder vielleicht sogar umgekehrt: Ist es nicht einfacher, mit einer flexiblen Raumbelegung auf Veränderungen des Bedarfs zu reagieren als erst im Gebäude technisch umzurüsten und umzubauen? Erstaunliche Tatsache ist jedenfalls, dass die umsetzbaren demontablen Trennwände nur ganz in wenigen Ausnahmefällen überhaupt versetzt worden sind. Und Tatsache ist es auch, dass die Präsenz der Wissenschaftler im Haus sich in engen zeitlichen Grenzen hält (dies aber vielleicht kein Sonderfall FU?). Anders als z.B. in Villeninstituten wie der AVL, die ihren gesamten Mikrokosmos in dem übersichtlichen Bereich ihres Hauses aufgehoben sieht und sich gegen das Ansinnen eines Umzugs in das "Monstrum Rostlaube" verwahrt.
Der philologische Fächerbereich der Freien Universität, der künftig in der "Rostlaube" räumlich und organisatorisch zusammengefaßt sein soll, verfügt über einen umfangreichen, fachlich ausdifferenzierten Literaturbestand von etwa einer ¾ Million Bänden. Bisher war dieser Bestand entsprechend der „historisch gewachsenen“ Struktur der FU dezentral aufgestellt bei den z.T. weit verstreuten Einzelstandorten der Institute. Eine generelle Besonderheit der FU im Vergleich mit anderen großen Hochschulen besteht darin, dass der überwiegende Teil der Literaturbestände den Fachbereichen zugeordnet ist, die für die Erwerbung und Betreuung zuständig sind. Dagegen beträgt der Anteil der Literatur, die bei der zentralen Universitätsbibliothek steht, nur ungefähr 25% (d.s. 2 Mio Bände von insgesamt rund 8 Mio Bde.) Diese traditionell starke Stellung der Fachbereiche bei der Bibliotheksorganisation ist jedoch mit den Haushaltseinschnitten der letzten Jahre zunehmend abgebaut worden. Die Philologien hatten anfänglich starken Widerstand geleistet gegen die Bildung einer gemeinsamen Bibliothek, in der alle Institutseinzelbestände zusammengeführt werden sollen. Vor dem Hintergrund der knappen personellen Ressourcen und Erwerbungsetats ließ sich dieser aber nicht mehr aufrechterhalten. Angesichts des Rationalisierungsdrucks mußten auch die Bedenken einzelner Institute, die Zusammenführung erschwere dem Nutzer den Zugriff und sei letztlich kontraproduktiv für den Wissenschaftsbetrieb, zurückgestellt werden. Allerdings wird sich wohl erst nach der Fertigstellung der Foster-Bibliothek zeigen, ob wirklich alle Fächer, insbesondere auch die kleinen, sich am Umzug beteiligen werden. Das dürfte auch davon abhängen, wie attraktiv die räumlich-funktionalen Bedingungen des Neubaus dann von den Nutzern eingeschätzt werden.
Die neue Philologische Bibliothek der FU
Die Planung von Hochschulbauten ist in der Regel einem komplizierten bürokratischen
Verfahren unterworfen: Da die hierfür benötigten Mittel – jedenfalls
bisher – aus zwei Quellen, nämlich seitens des Landes und des Bundes,
gespeist werden, sind Beantragung, Prüfung und Mittelfreigabe stets
auf diesen zwei Ebenen parallel zu betreiben. Wenn dann noch, wie im Falle
Berlins, das Land nur über geringe Mittel verfügt, verlängert
und verkompliziert sich der Planungsprozess entsprechend. Die FU hatte unmittelbar
nach der Asbestschließung der "Rostlaube" den Plan eines Neubaus einer
gemeinsamen philologischen Bibliothek auf den Antragsweg gebracht. Zunächst
sah es noch so aus, als ob Land und Bund dem zustimmen würden: Der Wissenschaftsrat
empfahl das Projekt jedenfalls grundsätzlich positiv. Mit der sich in
Berlin verschärfenden Haushaltssituation wurde dann jedoch der Neubau
vom Finanzsenator abgelehnt; es wurde der FU aber freigestellt, die von ihr
als notwendig erachtete räumliche Integration der Bibliotheken auf dem
Wege einer Umnutzungsplanung in der "Rostlaube" herzustellen. Als Kostendeckel
für alle erforderlichen Maßnahmen, also Asbestsanierung, Fassaden-
und Dacherneuerung, Modernisierung der Haustechnik, Umbau für die Institute
und Einbau der gemeinsamen Bibliothek wurde 1996 ein Betrag von 102 Mio DM festgesetzt. Auf dieser
Kompromisslinie musste nun verfahren werden: 1997 wurde ein beschränkter
Architektenwettbewerb durchgeführt, in dem Norman Foster den Zuschlag
für die Gesamtplanung erhielt.
Foster schlug zwei Varianten vor: Einmal die geforderte Einbaulösung
und zum andern einen neben die "Rostlaube" gestellten Neubau für die
Bibliothek, dem er in kosten- wie in funktionsmäßiger Hinsicht
den Vorzug gab. Die FU sah damit noch einmal eine Chance, ihr favorisiertes
Modell durchzusetzen. Der Senat blieb auch gegenüber den neuen Argumenten
hart; nur die Einbaulösung kam in Frage.
Im Entwurfsprozess, den Norman Foster und sein Berliner Büro vorantrieben,
ergab sich, dass die anfänglich an die vorgegebene Baustruktur der "Rostlaube"
noch relativ eng angepasste Bibliotheksform nicht optimal war. Es entstand
in der weiteren Durcharbeitung ein neuer Entwurf: Eine weit gespannte, kuppelförmige
Konstruktion, die aus einer zweischaligen membranartigen Hülle gebildet
werden soll. In diese Hüllkonstruktion soll eine sogenannte Etagere,
d.h. ein Betonskelett mit (zunächst 6, später) 5 Ebenen eingestellt
werden, das die Regale mit den Büchern und die Nutzerplätze trägt.
Die das Skelett überwölbende Hülle bietet die Möglichkeit,
im Zwischenraum der beiden Schalen die Heizung und Lüftung zu führen,
wobei ein intelligentes Meß- und Regelsystem automatisch das an das
Außenklima angepasste Raumklima einstellt. Zusätzlich werden
noch durch eine Betonkernaktivierung in den Decken des Skeletts Wärme-
bzw. Kühleffekte erreicht.
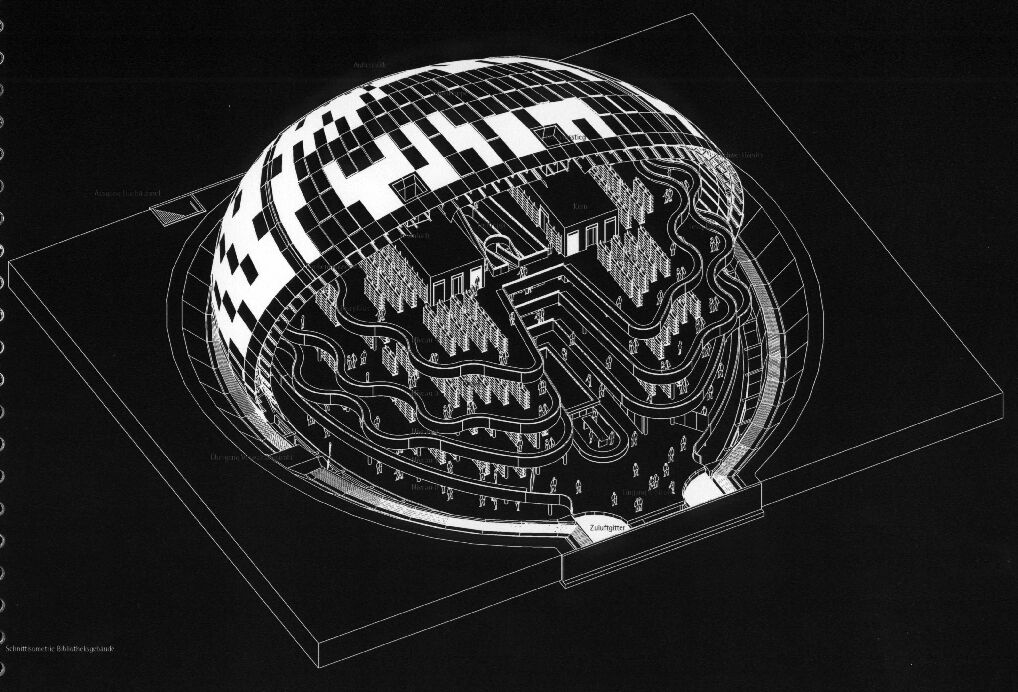
Das Besondere an dem von Foster konzipierten Bibliotheksraum scheint auch
die Art und Weise zu sein, wie der Bezug zu einer Reihe berühmter
Vorbilder hergestellt wird: Man kann etwa an The British Library oder auch
an die alte Berliner Staatsbibliothek denken – also weitgespannte Kuppeln über
einer großen Lesesaalebene, welche Gehäuse mit hoher innerräumlicher
Spannung bilden. Bei Fosters „Kuppel“, - abgesehen davon, dass es keine klassische
Kuppel ist, - bleibt aber der frei überwölbte Raum nicht wie bei
den alten Beispielen hohl und leer, sondern wird durch die eingestellte
Etagere genutzt, auf der die Bücher und Leseplätze ihren Platz haben. Ich
will der Frage nicht nachgehen, weshalb dann überhaupt noch eine
weitgespannte Hülle sinnvoll ist. Es sind auch verschiedene Varianten
des Tragsystems untersucht worden. Letztlich hat der entwerfende Architekt
entschieden (und der Kostendeckel wird wohl das letzte Wort haben!) Jedenfalls steht fest, dass sich
daraus eine äusserst intensive Nutzungsdichte ergibt. Dies kommt sowohl der direkten
Auffindbarkeit der Literaturbestände zugute wie auch der wünschenswerten
Nähe der Leseplätze. In der Außenerscheinung
schließlich stellt die die "Rostlaube" um fast das Doppelte ihrer bisherigen
Höhe überragende „Kuppel“ eine deutliche Maßstabs-Vergrößerung
dar und akzentuiert damit den FU-Campus in der Wissenschaftsstadt Dahlem in
neuer Form.
Es wurde in der Diskussion immer wieder davon gesprochen, damit werde
auch erreicht, dass die räumliche Identität der Universität,
die mit diesem Bibliotheksbau verbunden wird, an Deutlichkeit gewinnen könnte.
Wie Detlev Ipsen feststellt, hat aber Raum keine Identität. Der
Identitätsbegriff sei ein personaler Begriff: Identität beziehe
sich auf den Prozeß, durch den sich eine Person ihrer Subjektivität
vergewissert. Und weiter: „Soziale Beziehungen sind die kommunikative Basis
des Raumbezuges und diese wiederum ist die Grundlage der Identitätsbildung.“
Insoweit sind also für den Raumbezug unseres in Rede stehenden Baus zuerst
die sozialen Beziehungen wesentlich, die die Menschen, die hier arbeiten,
eingehen und die Kommunikation, die sie verbindet - welche Einflußgröße
dagegen der Entwurf von Norman Foster darstellt, scheint nachrangig - is'nt
it?
Ich komme zum Ende:
Ob der etwas fetzige Name „the brain“, der aus der organoiden Form der unter
der Hülle liegenden Schichten der Nutzebenen abgeleitet worden ist, die
Sache wirklich richtig trifft, darüber kann man wohl streiten. Frage:
Denken Bücher? Bewahren sie das kollektive Gedächtnis? Jedenfalls
ist der dort versammelte Literaturbestand nicht das Zentrum des gespeicherten
Wissens der FU – die bereits erwähnte dezentrale Struktur des Bibliothekssystems
besitzt ja eben mehrere Häupter (ob auch Hirne, wäre die Frage).
Aber immerhin: eine ¾ Million Bände ist ein beachtlicher Bestand,
einmal ganz abgesehen von dem qualitativen Gewicht der vereinigten Sprach-
und Literaturwissenschaften. Es bleibt also die Ähnlichkeit der (verdeckten!)
Form mit einem Großhirn, die den Namen vielleicht rechtfertigt oder
doch zumindest nahe legt. Und es ist eine Form-Analogie, die sich eigentlich
nur beim Betrachten der isometrischen Zeichnung einstellt. Welche anderen
Form-Assoziationen sich später aus der gebauten Realität noch ergeben
mögen, bleibt abzuwarten.
Es bleiben weitere Fragen:
War der Einbau der Bibliothek vielleicht doch ein zu harter Eingriff?
Wie vernetzt sich das neue Element mit der inneren Organisation der gesamten "Rostlaube"?
Hier wäre noch eine Information nachzutragen: Die innere Struktur der "Rostlaube"
soll im Rahmen der Sanierung grundlegend reorganisiert werden mit dem Ziel,
überschaubare und abgegrenzte Nutzungsbereiche für die Institute
herzustellen; dazu werden quasi neue „Institutshäuser“ im großen
„Haus Rostlaube" geschaffen.
Wie werden die Nutzer die neue Bibliothek annehmen? (Es gab durchaus Nutzerkritik
in der Planungsphase zu verschiedenen Punkten: Der ausgelagerte Bibliothekspersonal-Trakt
ist nur durch den Keller erreichbar, da abgeschlossene Büroräume in der Kuppel
nicht realisierbar sind. Funktionale Anordnung? Eingänge?)
Recht düster erscheint vor allem der finanzielle Horizont:
Welche Betriebskosten kommen damit auf die FU zu: Reinigungskosten der zweischaligen
Kuppel-Flächen? Kosten der Steuerung und Wartung der alternativen Energie-Technik?
Bauunterhaltung? Wird man sich die high-tech-Anlage bei sinkenden Etats auf
Dauer leisten können? Also noch einmal die Frage vom Anfang:
Was darf Wissenschaft in einer armen Stadt kosten?